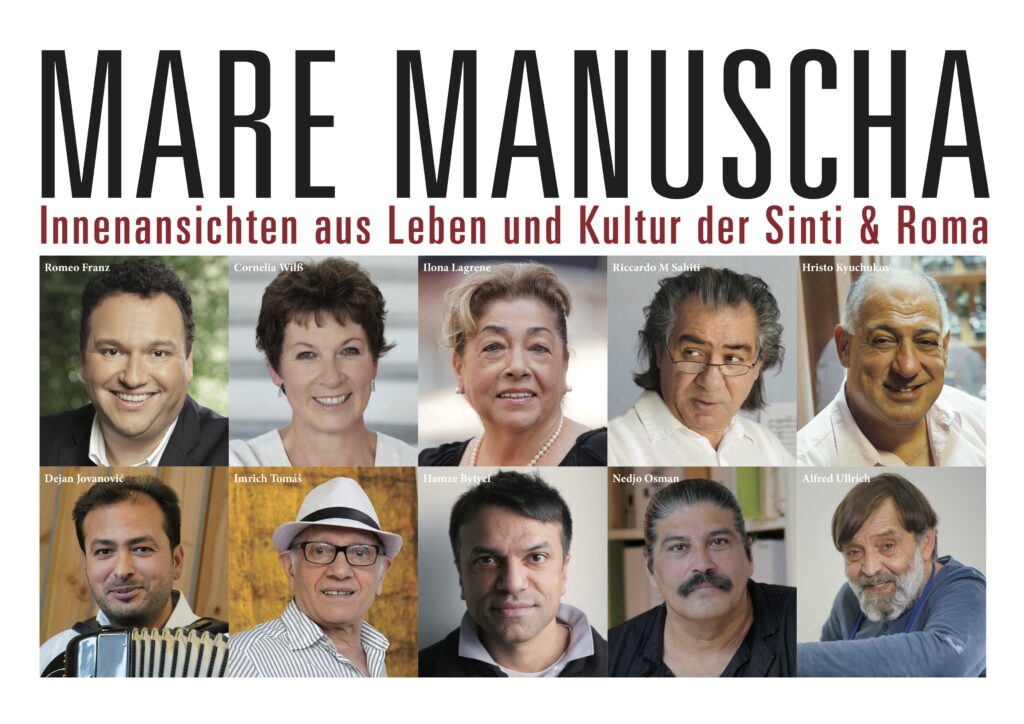Im Gespräch mit Nedjo Osman
Als einer von vier Brüdern wuchs Nedjo Osman, Jahrgang 1958, in einem Roma-Viertel in Skopje, in Mazedoniens Hauptstadt auf. In zwei bislang unveröffentlichten Texten erzählt der heute in Köln lebende Schauspieler von glücklichen Kindertagen. „Das waren die Tage, als wir Obst und Gemüse für den Winter einlegten. Wir wetteiferten dabei, als ginge es um die Weltmeisterschaft. Einlegen von Paprika und Tomaten, als würden wir das ganze nächste Jahr nur Paprikas und Tomaten essen, als gäbe es in Mazedonien nichts anderes. Der Ajvar aus Paprika, der Saft aus Tomaten, die gerösteten Paprikas und der gekochte und in Flaschen gefüllte Tomatensaft sowie in Einmachgläsern aufbewahrte geröstete Paprikas. Die ganze Stadt duftete nach Paprika, die man den ganzen Sommer lang in den Höfen briet. Wir Kinder spielten Fußball, während unsere Eltern den Ajvar rührten und die Zukunft planten“.
Titos Schüler
Der Vater arbeitete als Maschinenschlosser bei der jugoslawischen Eisenbahn; die Mutter als Putzfrau im mazedonischen Nationaltheater. 1963 verließ die Familie nach einem Erdbeben das Roma-Viertel und lebte fortan in einem Stadtteil, in dem nur die mazedonischen Gadže, die Nichtroma, wohnten. Erst dort, in neuer Umgebung, begann der junge Nedjo allmählich zu begreifen, was es bedeutete, ein Rom zu sein. „Ich musste Strategien finden, damit ich normal bleibe“, schreibt er in dem autobiografischen Text „Wie erfuhr ich, wer ich war“. Aber es gab auch die Erinnerung, wie es war, als ein „normaler“ Bürger in dem Vielvölkerstaat Jugoslawien zu leben, vor dem Krieg. „Ich erinnere mich an das Jahr, als ich eingeschult wurde und Titos Schüler wurde. Ich hatte eine Mütze mit rotem Stern auf dem Kopf und trug ein rotes Halstuch. Als wir Tito bei seinen Besuchen in Skopje begrüßen gingen, fiel der Schulunterricht aus. Wir warteten den ganzen Tag, bis er in seinem Auto vorbeigefahren kam und wir mit unseren kleinen Fahnen wedeln durften. Ich konnte ihn zwar nicht hinter den beschlagenen Autofenstern sehen, registrierte aber seine weißen Handschuhe.“
Osmans Vater war als sehr junger Mann bei den Partisanen gewesen und hatte seinen vier Kindern jahrelang vor dem Schlafengehen vom Krieg erzählt. Er erzählte, wie die Menschen nicht nur durch die Kugeln starben, sondern vom Schmerz, von der Sehnsucht nach der Freiheit für ihr Land getrieben waren. Er erzählte, dass die jungen Männer im Kampf gegen den Faschismus nicht zögerten, ihr Leben für das Land zu opfern, in dem alle Völker und nationale Minderheiten ohne Rücksicht auf ihr Alter, die Schönheit, die Hauptfarbe, die Musik gleich und gleichberechtig werden sollten. „Ich glaubte ihm und hörte ihm gerne zu. Diese Geschichten, mit denen wir großgeworden sind, ersetzten die Märchen über Rotkäppchen und Schneewittchen. Ich glaube, dass er das bewusst tat, obwohl die Kriegsgeschichten, die er uns kurz vor dem Einschlafen erzählte, nicht gerade eine leichte Kost waren. Ich glaubte an diese Geschichten, ich verstand, dass für meinen Vater dieser Teil seines Lebens sehr wichtig war. Ich glaubte an seine Hoffnung an die Zukunft und blieb gern lange wach, um ihm zuzuhören, obwohl es mir am nächsten Tag schwerfiel, früh aufzustehen und in die Schule zu gehen.“
Dann aber kam, erinnert sich Nedjo Osman, mit der Zerschlagung Jugoslawiens erst der Schock und dann kam die Enttäuschung. Die Träume waren verflogen. Früher hatte sich der Vater immer an erster Stelle als Jugoslawe, und dann erst als Rom gefühlt, jetzt aber bezeichnet er sich ausschließlich als Rom.

Nedjo Osman mit 29 Jahren. Foto: privat
Alice im Wunderland
Gern erzählt Nedjo Osman, wie er als kleiner Junge von seiner Mutter ins Theater mitgenommen wurde, wenn sie ihrer Arbeit nachging. Sie ließ das Kind im verdunkelten Saal in der letzten Reihe sitzen und die Proben von Opern, Theaterstücken und Ballett miterleben … „Meine Mutter liebte das Ballett. Ich saß dort ganz allein, umgeben von einer seltsamen Stille und einem seltsamen Geruch, den ich nie vergessen habe. Dort begann mein Traum, den ich zu Wirklichkeit machen wollte, der Traum, der mich zu den Wundern führte. Ich war dabei der Schauspieler und spielte die Hauptrolle, ähnlich der Alice im Wunderland.“
Mit der Schauspielerei angefangen hat Nedjo Osman im Ensemble des Roma-Theaters „Pralipe“ (deutsch: Brüderlichkeit), das ihn ein paar Jahre nach Nordrhein-Westfalen führte. Möglich gemacht hatte das Robert Ciulli, der künstlerische Leiter des Theaters an der Ruhr, der das Pralipe-Ensemble nach Ausbruch des Krieges 1991 eingeladen hatte, nach Mülheim an der Ruhr umzusiedeln. Viele männliche Hauptrollen der Stücke, die Pralipe in viele europäische Städte führten, wurden mit Nedjo Osman besetzt. Nach zwei, drei Jahren war er sich sicher, bekennt er, dass er als Schauspieler arbeiten wollte und ist an die Film- und Theaterakademie im serbischen Novi Sad gegangen. Dort schloss er sein Studium an der Film- und Theaterakademie unter anderem bei Rade Šerbedžija ab.
„Als ich mich für die Aufnahmeprüfung an der Schauspielakademie Kunstakademie im serbischen Novi Sad anmeldete, beschloss ich, einen Monolog in der Roma-Sprache vorzutragen. Das tat ich auch. Ich sprach den König Ödipus auf Romanes und verspürte dabei eine Unruhe in der 14-köpfigen Prüfungskommission. Eine Professorin wandte ein, sie habe mich nicht verstanden, ich fragte sie daraufhin, ob sie denn nicht das Drama vom König Ödipus gelesen hätte, die übrigen Mitglieder der Prüfungskommission lachten. Ich kniete mich dann vor sie hin und sprach den langen Monolog Othellos auf Serbisch. Ohne Zögern wurde ich in die Akademie aufgenommen.“
Nedjo Osman erwähnt oft in unseren Gesprächen, dass er in seiner beruflichen Laufbahn in seinem Umfeld oft der einzige Rom war. Die Erfahrungen aus der Schulzeit in Mazedonien haben ihn sein Leben lang begleitet. Sie nannten mich den „Zigeuner, Zigeuner, Zigeuner“ … Das hat mich geschmerzt. Am Anfang des Studiums überlegte ich, welche Strategie ich anwenden sollte, denn ich befand mich in einer ähnlichen Situation wie früher in der Schule: Ich war der einzige Rom in der ganzen Akademie. Da beschloss ich, jeden Morgen die Akademie mit dem Lied „Dželem, dželem“, der Roma-Hymne, zu betreten. Außerdem erzählte ich ständig von Roma, ob man mich danach fragte oder nicht, bis niemand mehr etwas davon hören wollte. Auf diese Weise wurde ich den anderen gleich, und das Thema Roma wurde normal und nebensächlich. Meine Strategie war: Besser, ich spreche über die Roma, als dass sie es tun. Es spielt keine Rolle, ob ich stolz darauf bin, dass ich ein Rom bin: Ich bin es einfach.
Weißt du, wie ich heiße?
Eigentlich kennst du mich nicht
Weißt du, wie ich heiße?
Nicht so, wie du mich nennst.
Ich bin gegen dieses Wort.
Du nennst mich ohne Erinnerung,
Ohne Meinung,
Ohne Gefühl.
Du nennst mich Zigeuner.
Du nennst mich so und das tut weh
Weckt in mir tausend Bilder
Schwarz wie der Rauch.
Du nennst mich Zigeuner
Weißt du überhaupt, was das ist?
Du nennst mich so und bringst um
Meine Mutter, meinen Vater, meinen Bruder
Du nennst mich so und hörst nicht das Wehklagen
Erinnerst mich an die Trauer
Und so kehrt die Angst zurück,
Als Möglichkeit,
Dass es morgen wieder geschieht.
Nenne mich nicht mehr
Zigeuner, Gipsy, Gitan, Zitan
Nenne mich nicht so, wie es mir wehtut
Nenne mich so, wie ich es mag.
Wie heiße ich?
Rom, Sinto, Manusch, Kale
So, wie der Vogel fliegt,
So, wie du die Musik hörst,
So wie die Freiheit,
Die du hast
Und von der ich träume.

Nedjo Osman und Nada Kokotović leiten das Europäische Roma Theater TKO, Foto: Alexander Paul Englert
Heimat ist meine Sprache
Nach dem Studium gastierte er am serbischen Nationaltheater in Novi Sad und am Jugoslawischen Dramatheater Belgrad, zudem war er als Theaterschauspieler am Nationaltheater KPGT in Subotica tätig. Er übernahm Hauptrollen in zahlreichen Inszenierungen von der Klassik bis zur Moderne und wurde für seine Schauspielkunst vielfach ausgezeichnet. Er gab den Leonardo in Federico García Lorcas Bluthochzeit, in Shakespeare-Aufführungen den Romeo in Romeo und Julia oder eben den Othello im gleichnamigen Drama und brillierte in vielen anderen Rollen unter der Regie von Rahim Burhan. Die Rolle des Othello ist dem Schauspieler wohl auf den Leib geschnitten. Das sei seine Lieblingsrolle bis heute, sagt Nedjo Osman.
Im Jahr 1995 verließ Osman das Pralipe-Theater und arbeitete in Köln mit seiner Lebensgefährtin Nada Kokotović zusammen. Die aus Zagreb stammende kroatische Tänzerin, Choreographin und Theaterregisseurin Nada Kokotović hatte in Jugoslawien als Künstlerin große Erfolge gefeiert. Der Krieg und der politische Zerfall ihrer Heimat zwangen die überzeugte Weltbürgerin zum jähen Abbruch ihrer Karriere in diesem Sprach- und Kulturraum. 1992 emigrierte Nada Kokotović nach Deutschland. Das gemeinsame Theaterprojekt TKO – Europäisches Roma-Theater in Köln wird ein Erfolg. Ist Nedjo Osman in Köln heimisch geworden? Die Antwort fällt so aus: „Heimat ist meine Sprache. Heimat ist mein Gefühl. Indien, das Herkunftsland der Roma, ist unsere Geschichte. Aber ich bin Europäer. Ich bin in Skopje geboren, und früher habe ich gesagt, Jugoslawien ist mein Land. Aber die Länder Ex-Jugoslawiens heute … die sind nicht mehr mein Land. Da spielen jetzt zu viele Nationalismen eine Rolle. Was habe ich damit zu tun? Gar nichts. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist zusammengebrochen. Mein Land ist Nippes.“
Nedjo Osman wechselt häufig die Sprache. Am Telefon oder wenn er sich in Mazedonien mit seinen alten Leuten unterhält, spricht er Mazedonisch, was aber nicht seine Muttersprache sei, betont er. Mit seiner Partnerin, Nada, die Kroatisch spricht, mischt er das Kroatische mit serbischen Klängen. Wenn er mit Roma unterwegs ist, spricht er Romanes. Dreht er, wie augenblicklich, in Serbien eine Fernsehserie, spricht er Serbisch. Mit der deutschen Journalistin unterhält er sich auf Deutsch. Seine Texte scheibt er in Serbokroatisch und überträgt sie selbst ins Romanes.

Szenenfotos aus dem Theaterstück „Schwarzbrot“ (TKO-Theater)
Mit eigener Stimme
Vielstimmigkeit und Vielsprachigkeit spiegelt sich auch im TKO-Theaterprojekt. Auf dem Spielplan stehen Stücke von Heiner Müller bis Shakespeare, bearbeitet unter der Regie von Nada Kokotović. Angelehnt an Nedjo Osmans Vision hat sich das Theater auch der Aufgabe gestellt, auf dramaturgische Art und Weise die Roma-Kunst im Kampf gegen Diskriminierung und Stereotypen zu stärken und das Bild der Roma in der Gesellschaft zu verändern. Zum Beispiel in Rukeli, einem Schauspiel über den Sinto-Boxer Johann Wilhelm Rukeli Trollmann, den die Nazis im Konzentrationslager ermordet haben, oder in dem Theaterstück Schwarzbrot, worin es um Abschiebung geht, oder im Stück ZigeunerSchnitzel. Im November 2019 wagte sich das TKO-Theater unter dem Titel Mit eigener Stimme an eine dramatische Interpretation des Projektes Voices of the Victims nach einer Sammlung der Historikerin Dr. Karola Fings für den Archivbereich Holocaust im RomArchive. In Szene gesetzt werden als Gegenerzählung zu dem von den Täterinnen und Tätern konstruierten Bild frühe Selbst-Zeugnisse von Sinti und Roma aus zwanzig Ländern, die Opfer der NS-Verfolgung wurden: geheime Nachrichten, Gnadengesuche, Zeugenaussagen. Berührende, verstörende Momente von Intimität und Trauer. Bis heute haben nur wenige solcher Zeugnisse Raum in der deutschen Erinnerungsarbeit bekommen.
„Wir sollten über die Bedeutung von Verfolgung und Völkermord während der Jahre 1933 bis 1945 für Sinti und Roma in seiner europäischen Dimension nicht nur reden, sondern „es auch zeigen“, sagt Nedjo Osman nach einer Aufführung im Rhenania Theater in Köln „wie es für die Juden und andere Opfergruppen oft gemacht wurde. Es gibt so viele Spielfilme, so viele Theaterstücke und so viele Dokumentarfilme zu diesem Thema, aber nicht über die Opfer von Sinti und Roma.“
Der Zorn und seine Ungeduld mit der Mehrheitsgesellschaft, die kein Bewusstsein für die Verbrechen des NS-Regimes an den Roma und Sinti entwickelt hatte, sind schmerzlich fühlbar. Doch auch die Sinti und Roma hätte große Fehler gemacht. „Unsere Leute wissen nicht genug darüber, dass Kunst ihre eigene Art und Sprache hat, um Informationen zu vermitteln. Sie kooperieren nicht genug mit uns Künstlern, kontaktieren uns nicht richtig und wissen nicht, wie wir helfen oder zur Lösung eines Phänomens oder Problems beitragen können. Solche ernsten Themen müssen seriös, professionell und qualitativ behandelt werden.“
Ein heißer Sommertag im August 2024. Ich bin mit Nedjo Osman und Nada Kokotović am Bonner Hauptbahnhof verabredet. Wir wollen uns mit seiner Übersetzerin, Mirjana Wittmann, treffen, die die meisten der Gedichte Nedjo Osmans aus dem Serbischen ins Deutsche übersetzt hat. Denn der Theatermann, der immer wieder Fernsehrollen übernimmt, ist auch ein Übersetzer für Romanes und ein Dichter, der schon in früher Jugend seine Leidenschaft für das Schreiben entdeckt hat. In seinen „Liedern“, so spricht Nedjo Osman über seine Gedichte, wohnt die melancholische Lakonie, das Leben und die Liebe zu feiern. Mehr noch: In seiner Poesie verleiht der Gesang der Roma den Schmerz und die Trauer. Die Gedichte machen die Roma „als Teil der zeitgenössischen Poesie für uns hörbar“ (Tonko Maroević, Literaturkritiker).
Die Wahrheit
Dies ist keine Beichte,
Dies ist schlimmer als meine Trauer.
Tausendmal sage ich morgens zu meinem Sohn,
Dass ich ihn liebe und dass die Wahrheit eine Tugend ist.
Tausendmal habe ich heute Morgen
Wieder Angst um ihn.
Wir haben uns verloren im Wirbel der Landkarten
Wir sind verstreut wie Spielzeug für eine Feier
Wir sind wie Hexen in den Märchen
Gibt es noch Schmerzen, an denen man erkennt,
Dass es wehtut, dass du existierst,
Dass auch du ein Mensch bist,
An denen man erkennt,
Dass wir alle nackt geboren sind.
Seit tausend Jahren wiederhole ich meinem Kind,
Dass alles vorbei ist,
Dass wir nicht ein Teilchen sind,
Verloren am Meeresgrund.
Wir sind aber das reinste Teilchen,
Das in der Brust leuchtet
Und die Geschichte, dass wir aus Indien kommen,
Ist kein Wiegenlied,
Sondern die Wahrheit.
Inspiration für die Texte, die über viele Jahre hinweg entstanden sind, sind die Straße, das Viertel, in dem die Roma leben, die Erfahrungen mit den Nicht-Roma und die Liebe als Quelle der Schönheit. Viele der Gedichte, die ihren ganz eigenen Rhythmus haben, sind in der Türkei, in Serbien, Mazedonien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Holland und Deutschland erschienen. Ins Deutsche wurden die meisten der Texte, die Nedjo Osman auf Serbokroatisch oder auch Kroatoserbisch schreibt, von dem Übersetzer-Paar Klaus und Mirjana Wittmann übertragen. Eine umfassende Sammlung der Gedichte in deutscher Sprache liegt (noch) nicht vor.
Ein verrücktes Gedicht
Wenn ich mich betrinke,
Werde ich zu einem Pferd,
Ich schwöre es dir.
Und mein Herz ebenfalls.
Wieder nüchtern,
Werde ich zu einem Lamm
Und sehe nur sie
Und verliebe mich.
In der Dunkelheit küsse
Und umarme ich sie.
Wenn das Licht angeht,
Ist sie verschwunden.

Nedjo Osman mit seiner Mutter. Foto: privat
Warum nimmt die Liebe sehr viel Raum in seiner Poesie ein, frage ich den schreibenden Nedjo Osman. „Die Liebe spielt eine große Rolle in meinem Leben. Ich habe das von zuhause. Meine Mutter hatte eine große Liebe in sich getragen, ob es kleine Kinder waren oder eine Blume – sie kannte keinen Hass und war allem in großer Liebe verbunden. Bis zum letzten Moment, als sie starb. Und das hat mein eigenes Schreiben tief beeinflusst. Letztlich schreibe ich immer über die Liebe. Mein Vater lehrte uns zu lieben, weil ein Mensch, der liebt, nicht imstande sei zu hassen. Weil es ein Mensch, der lieben könne, nie schwer im Leben haben werde. So sprach mein Vater. Man müsse sein Land lieben, seine Stadt, sein Haus, seine Straße, seine Freunde, alles um sich herum.“
So spricht Nedjo Osman.