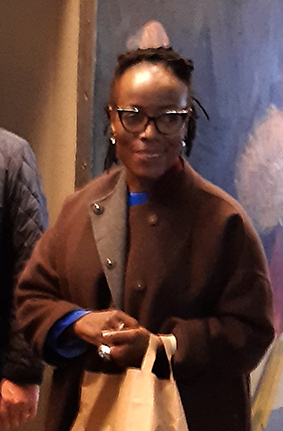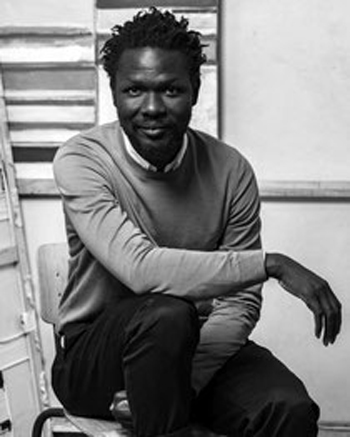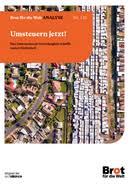Dokumentarfilm von Peter Heller, Deutschland 2019, 100 min
Produktion: filmkraft
Recherchen, Mitarbeit an Konzeption u.a.: Cornelia Wilß
Der Film nimmt uns mit auf eine Reise zu Schauplätzen, wo alte afrikanische Kunst zum Leben erwacht. In ländliche Regionen, wo geheimnisvolle kunstvoll geschnitzte Masken im Tanz lebendig werden, die Ahnen gütig stimmen sollen und die Götter verehren. Zu den Märkten in Togo, wo Fetische neben Kitsch und Kommerz an Touristen verkauft werden. Zu Zwischenhändlern, die viel wagen, um noch originale Kulturgegenstände aufzutreiben, mit denen sich lukrative Geschäfte machen lassen.
Der Markt in Afrika ist, wie der Kunstexperte, K.F. Schädler sagt, leer gefegt. Gewinne erzielt der Sammler nur noch mit Prachtstücken, die schon seit hundert Jahren durch den Norden der Welt von Sammler zu Sammler geistern, in hippen Galerien und Ausstellungen gezeigt und auf hochdotierten Auktionen in Paris, Zürich und London gehandelt werden.
Derweil lagern in den ethnologische Museen Europas Abertausende von schönen Alltags- und Kultgegenständen aus Afrika, unbesehen von der Öffentlichkeit, und legen eine Staubschicht an. Berühmte Museen wie das Musée de quai Branly zeigen nur einen Bruchteil ihres Fundus. Einzelstücke von besonderer Pracht, die Heerscharen von Besuchern anziehen, sind der ganze Stolz der Museumsleute in Paris genauso wie in Berlin.

Der Jugend Afrikas werden die Schätze ihrer eigenen Kultur oftmals erst auf der Touristenroute durch Europa als Verluste bekannt. Das Wissen um den Wert der eigenen uralten Kulturen anhand von Objekten, die nun nach Afrika zurückgegeben werden sollen, ist für Intellektuelle wie Prof. Felwine Sarr und Dr. Ibou Coulibaly ein Hauptmotiv für die Restitution. Auch für die Politologin Dr. Aissa Halidou aus Niamey (Niger), Dr. Romouald Tchibozo (Tansania) und Dr. Salia Male, Leiter des Nationalmuseums in Bamako stellen die Rückgabe aller Kulturgüter einen notwendigen Akt von De-Kolonisierung dar: als Wiedergutmachung und als Chance der Wiederaneignung der eigenen Geschichte, welche durch den Verlust der Kulturobjekte unterbrochen wurde.
Aber was ist Raubkunst? Die Bestände und Ausstellungen von außereuropäischer vorkolonialer und kolonialer Kunst- und Kultur geraten ins Rampenlicht der medialen Aufmerksamkeit. KuratorInnen und ExpertInnen stehen unter Erklärungsnot. Sie sehen ich mit dem Vorwurf konfrontiert, dass eine Zuschaustellung von Objekten zur Erbauung der europäischen Betrachter, aus dem Kontext ihrer Herkunftskulturen gerissen, die schmerzhafte Geschichte kolonialer Enteignung fortschreibt. Die im Film nacherzählte Geschichte des prächtigen Throns „Mandu Yenu“, der als „Geschenk“ der Ethnie der Bamoun in den Besitz des mächtigen deutschen Kaisers in Berlin überging, in Dahlem ausgestellt war und nun ins umstrittene Berliner Schloss ziehen soll, spürt der großen Symbolkraft eines „Geschenks“ in der Spiegelung deutscher Kolonialgeschichte nach.
In der Vergangenheit waren die „Völkerkundler“ Verwalter rassistischer Ideologien. Das Selbstverständnis der Ethnographen des 21. Jahrhunderts dagegen ist anders angelegt. Hier beschreiben prominente Fachleute die Herausforderungen einer neuen Museumspraxis.
Der Autor (und Produzent) Peter Heller profitiert bei diesem Filmvorhaben von seinem reichen Archiv an Filmschätzen aus eigener, mehr als dreißigjähriger Filmarbeit in Tanzania, Kamerun, Namibia, Senegal und Mali: Geschichten um Museumschätze in Europa und Kulturverlust in Afrika auf einer Missionsstation am Fuße des Kilimanjaro. Die Beobachtungen und Reflektionen von noch lebenden Zeitzeugen über den Verlust des Schiffsschnabels von Kameruns Küste oder des „Throns „Mandu Yenu“ hatte er schon in den siebziger und achtziger Jahren in Ost- und Westafrika aufgezeichnet. Bei seinem Film Markt der Masken sei das ebenfalls so gewesen, wie er im Filmgespräch im Deutschen Filmmuseum im Januar 2022 in Frankfurt am Main erzählt. Der Film wurde 2019 – stark erweitert – unter dem Titel Verkaufte Götter – Der neue Markt der Masken mit der ARD-Programmprämie ausgezeichnet und war 2021 für den Grimme-Preis nominiert.
Ein Filmgespräch
Cornelia Wilß:
Sie haben 2015 für das Fernsehen Markt der Masken gedreht, zwischendurch kam ein Anruf von arte, Anfang 2019, dass man diesen Film, der sehr positiv aufgenommen worden war, wiederholt. Und damit waren Sie ganz und gar nicht
einverstanden. Warum?
Peter Heller:
Die Restitutionsdebatte, die der französische Präsident Emmanuel Macron in Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso erhoben hatte, begonnen hatte, führte zu einer ziemlichen Resonanz in der afrikanischen Diaspora aber auch bei Intellektuellen in Frankreich und Europa. Das hat alles auf den Kopf gestellt. Ich habe gesagt, der Film ist nicht sendbar, das kommt nicht in Frage. … Ich fand das falsch. Der alte Film (Markt der Masken) erzählte über unsere
Beziehung zu den Masken, zu den Museen und was für ein Markt daran hängt. Jetzt ging es darum, dass das Thema eine politische oder eine ideologische Funktion bekommen hat, die aus meiner Sicht nicht ganz so eindeutig zu beurteilen ist. Ich wollte keinen Film machen, der alles zu beantworten weiß. Ich wollte Fragen stellen.
Cornelia Wilß:
Als die Entscheidung, den Film fürs Fernsehen zu überarbeiten, fiel, musste es schnell gehen. Wie ist es gelungen, in so kurzer Zeit an Material zu kommen?
Peter Heller:
Der Film setzt sich aus verschiedensten Quellen zusammen. Es war nicht möglich, aus dem alten Material einen Film zu machen, wie ich mir das vorstellte. Der Vertrag mit dem Fernsehen sah vor, dass sich nur 13 Prozent verändern sollte, schließlich ist es viel mehr geworden. Nachträglich ist das von arte akzeptiert worden. Wir mussten viel improvisieren …
Cornelia Wilß:
Ein Beispiel bitte!
Peter Heller:
Das Ganze war nur möglich wegen der Zusammenarbeit mit Menschen, die ich gut kannte und die für mich nach langen Telefonaten Dreharbeiten in Afrika übernommen haben. Mit Wilfried Hoffer zum Beispiel, einem alten Freund, der hier sitzt und der früher Redakteur beim ZDF war, hatte ich das erste Mal einen Film über afrikanische Kunst gemacht: über den Königsthron Mandu Yenu, der als “Geschenk” der Bamoun in den Besitz des mächtigen deutschen Kaisers in Berlin lange Zeit in Dahlem ausgestellt war und nun ins Berliner Schloss gezogen ist. Die Beobachtungen und Reflektionen von noch lebenden Zeitzeug*innen über den Verlust des Schiffsschnabels von Kameruns Küste oder eben des Bamum-Throns habe ich schon in den siebziger und achtziger Jahren in Ost- und Westafrika aufgezeichnet. Damals hatte Hoffer den Film Mandu Yenu möglich gemacht, und ich wusste, dass er Anfang 2019 gerade in Mali war. Ich habe dann auch beim malischen Fernsehen angerufen, wo ich die Kameraleute kannte, und dann hat Wilfried Hoffer mit ihnen im Museum in Bamako gedreht.
Cornelia Wilß:
Sie sagen, Fernsehfeatures seien nicht Ihre Sache. Sie arbeiten oft viele Jahre an einen Film, drehen Langzeitstudien, kehren immer wieder zu Ihren Filmfiguren und den Menschen
dahinter zurück. Ist es Ihnen schwergefallen, hier einen Film mit heißer Nadel zu stricken?
Peter Heller:
Ich habe meinen Film Verkaufte Götter wirklich mehr als eine politische Aufgabe betrachtet – das sind cineastische Ansprüche vielleicht etwas zu kurz gekommen. Ich hätte den Film mit mehr Ruhe und Sorgfalt herstellen wollen, aber ich fand es wichtig, eine neue, aktualisierte Version zeigen zu können. Und das wurde dann auch geschätzt. Allerdings hat mir die Produktionsleiterin vom NDR-Fernsehen gesagt, Herr Heller, Sie sind doch verrückt, Sie zahlen doch drauf, aber ich sagte mir, dass ich keineswegs einen »falschen Film” wollte. Das war es mir Wert.


Ein Filmgespräch
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.